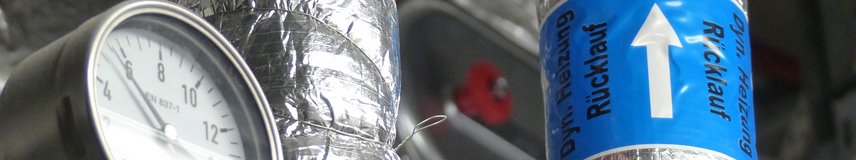Weniger dick dämmen, dafür mehr Haustechnik, die mit erneuerbar erzeugtem Strom arbeitet. In einem großen Projekt hat die Wohnungsbaugenossenschaft Märkische Scholle in Berlin-Lichterfelde gezeigt, wie Gebäudesanierungen effizienter als bisher ausfallen könnten. Die Vorteile sind in der Studie "Energiewende. Irrtümer aufbrechen, Wege aufzeigen" beschrieben. Sie wurde vergangene Woche in Berlin vorstellt
Treibende Kraft hinter der Studie ist der Architekt Taco Holthuizen. 450 Wohnungen sind nach seinen Plänen in Lichterfelde saniert worden, noch einmal so viele sollen folgen. Geheizt wird mit Wärmepumpen, die zum großen Teil mit erneuerbarem Strom vom eigenen Dach betrieben werden. Außerdem ziehen sie Wärme aus dem Erdreich. Das liefert 40 Prozent der Energie. Solarthermie auf dem Dach erzeugt ebenfalls Warmwasser und liefert 30 Prozent der Gesamtenergieverbrauchs. Lüftungsanlagen in den Wohnungen entziehen der Luft die Wärme und speisen sie in den Heizkreislauf zurück. Das bringt noch einmal 30 Prozent. Warmwasserspeicher in den Kellern und im Erdreich puffern die Energie.
Energieströme optimal gesteuert
Das Herzstück der Sanierung ist eine Steuerungsanlage, die für die optimale Regelung der Energieströme sorgt. Hier haben die Märkische Scholle und Holthuizen dazugelernt: Während sie anfangs in jeden Block eine Steuerung gebaut haben, versorgt in einem späteren Bauabschnitt eine Anlage fünf Blocks.
An den Verbrauchsdaten der schon fertiggestellten Wohnungen lässt sich zeigen: Ihr Energieverbrauch ist um 96 Prozent gesunken, berichtete Holthuizen bei der Vorstellung der Studie. Die kleine Siedlung erreicht Werte von 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist heute schon besser als der Standard, der bis 2050 in jedem Gebäude erreicht werden soll, nämlich 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter, sagt Holthuizen.
Viel hilft nicht viel
Der Architekt ärgert sich besonders über die "Fehlanreize", die mit den Fördervorschriften der KfW gesetzt würden: Um die Förderung zu erhalten, müssten Dämmstärken eingehalten werden, die nur noch einen geringen Grenznutzen hätten. Der BBU kritisiert: "Ab einer Dämmdicke von acht Zentimetern führt jeder weitere Zentimeter Materialaufwand nur noch zu einer exponentiell abnehmenden Einsparung beim Heizwärmebedarf, während der Kosten-, Ressourcen- und Primärenergieaufwand des Materials linear zunimmt. Die Folge sind explodierende Baukosten bei allenfalls noch minimalen Einsparergebnissen",. Trotzdem sei die Dämmdicke nach wie vor die wesentliche Stellgröße innerhalb der deutschen Fördersystematik.
Um in den Genuss einer KfW-Förderung zu kommen, hat auch die Märkische Scholle stärker gedämmt, als sie es selbst für richtig hielt: Zehn Zentimeter hätten für die Behaglichkeit gereicht, 14 Zentimeter wurden aufgebracht, bis zu 24 Zentimeter verlangen KfW-Standards.
Annähernd warmmietenneutral
Die "graue" Energie in den Dämmungen, also der Energieaufwand bei der Herstellung, müsse in die Gesamtbilanz einbezogen werden, fordert BBU auf der Grundlage von Erfahrungen der Märkischen Scholle deshalb. Dem BBU geht es aber nicht nur um eine effiziente, sondern auch um eine bezahlbare Energiewende im Gebäudesektor. Ganz umsonst sind die Maßnahmen aber auch für die Mieter der Märkischen Scholle nicht. Nach der Sanierung – die Wohnungen wurden komplett mit neuen Bädern und Fenstern ausgestattet – zahlen die Mieter 1,90 Euro pro Quadratmeter mehr. Die Betriebskosten für Energie sanken dafür um rund einen Euro, so dass am Ende etwa ein Euro Mietsteigerung pro Quadratmeter übrigbleibt, berichtet Jochen Icken vom Vorstand der Märkischen Scholle. Die Sanierung war also nicht ganz warmmietenneutral.
Auf dem freien Wohnungsmarkt wäre die Umlage allerdings noch höher gewesen. Die Märkische Scholle legte nur ein Drittel der gesetzlich erlaubten elf Prozent um, weil es sich bei den Mietern ja auch um Miteigentümer handelt. Im Koalitionsvertrag ist geregelt, dass Mieten nach Modernisierungen sechs Jahre lang um nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter steigen dürfen.
SPD-Politiker nimmt Anregung auf
Der SPD-Experte für Wohnungspolitik im Bundestag, Klaus Mindrup, will die Ergebnisse der Studie mitnehmen in die Beratungen um das neue Klimaschutzgesetz. Es soll 2019 beschreiben, wie die einzelnen Sektoren ihre Klimaziele für 2030 erreichen. Der Gebäudesektor muss die Emissionen gegenüber 1990 um 66 bis 67 Prozent mindern, steht im Klimaschutzplan 2050. Das entspricht einer absoluten Menge von 209 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Davon waren 2014 rund 119 Millionen Tonnen geschafft. Auch das geplante Gebäudeenergiegesetz – ein erster Vorschlag soll im September herauskommen – müsse stärker auf die Effizienz von Sanierungen eingehen, sagte Mindrup. von Susanne Ehlerding