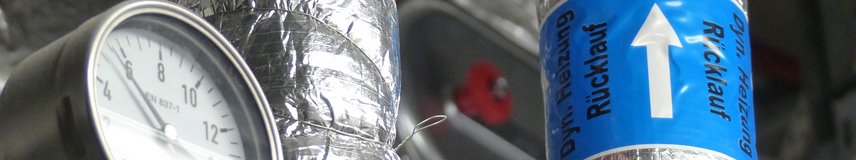Kaminöfen und Pellet- sowie Holzheizungen stehen bildhaft für Behaglichkeit und Komfort. Dennoch sind sie umstritten. Auch weil sie häufig als umweltschädlich eingeschätzt werden. Aufgrund von Rauch und Emissionen gibt es zahlreiche Nachbarschaftsbeschwerden. Kamin- und Kachelöfen aus den Baujahren von 1985 bis 1990 müssen bis Ende 2020 ersetzt oder mit Feinstaubabschneidern nachbestückt werden. Bis Ende 2024 sind Öfen der Baujahre 1995 bis 2010 dran. Die Partikel von Feinstaub werden zum Großteil durch Verbrennung freigesetzt. Neben der Industrie tragen Heizungen zur Entstehung bei. Aufgrund der geringen Größe und der chemischen Zusammensetzung sind sie schädlich für unsere Gesundheit. Feinstaubschneider minimieren den Ausstoß.
Dennoch ist eine Nachrüstung zunächst lästig. Die Branche selbst möchte diese Komplikationen verhindern. Daher wurde in Lösungen investiert. Diese sollen nicht bloß dazu beitragen das Bild von Kaminöfen und Pelletöfen zu verbessern, sondern für eine saubere Luft dank weniger Emissionen sorgen. Manche Hersteller geben an, den Feinstaub besiegt zu haben. Heizungen von KWB sollen nahezu emissionsfrei sein. „Durch intelligente Verbrennungstechnik werden bereits weniger Emissionen erzeugt und durch dezidierte Partikelabscheidung in der Heizung werden diese stark reduziert. Mittels Abgasrezirkulation als Primärmaßnahme sowie über den Einbau von KWB Staubfiltern als Sekundärmaßnahme ist das Abgas bei Hackgut- und Pelletheizungen nun nahezu partikelfrei“, sagt Helmut Matschnig, Geschäftsführer von KWB. Aufgrund modulierender Kaskaden-Anlagen sowie intelligente Energiemanagement-Systeme soll eine Steigerung der Systemeffizienz herbeigeführt werden. Brennstoff soll eingespart werden, geringere Emissionen sollen durch eine Minimierung der Start-/Stopp-Phasen ausgestoßen sein. Auch der Kaminofenhersteller Buderus sagt, dass seine Anlagen keine Feinstaubfilter benötigen, da die Kaminöfen alle regulatorischen Bestimmungen erfüllen. Mit einer digitalen Abbrand-Regelung soll zudem eine Technologie angeboten sein, welche einen effizienten und emissionsarmen Abbrand mit dem typisch gemütlichen Flammenbild ermöglicht und die Brennstoffmenge senkt.
Emissionen mit Gütesiegeln bekämpfen
Doch es gibt auch andere Positionen. Dass Heizen mit Holz grundsätzlich klimaschonend sei, sollte relativiert werden. „Das Heizen mit Holz verursacht in Deutschland mittlerweile deutlich mehr Feinstaub als die Motoren von Pkw, Lkw und Bussen zusammen. 80 bis 90 Prozent der Partikel aus Holzöfen und -kesseln haben eine Größe von unter einem Mikrometer“, sagt Patrick Huth, Projektmanager Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Denn diese Partikel seien gesundheitlich besonders relevant, weil sie besonders tief in den Körper eindringen. Darüber hinaus würden vor allem die Scheitholzöfen eine substantielle Menge Ruß ausstoßen.
Eine Lösung welche sowohl Freunde wie Gegner von Kaminöfen eint ist der Wunsch nach einem gemeinsamen Gütesiegel. Dieses könnte für mehr Vertrauen sorgen und Benutzer vor teuren Nachrüstungen schützen. „Aus Sicht der DUH ist der Blaue Engel das vertrauenswürdigste Umweltzeichen. Als Typ 1-Label garantiert er ein transparentes Verfahren und eine herstellerunabhängige Kontrolle der Vergabekriterien“, so Huth. Das europäische Umweltzeichen sei noch unbekannt, könne aber an Bedeutung gewinnen. Denn weite Teile der Umweltgesetzgebung sind nicht nur bei der EU angesiedelt, ein gemeinsames Gütezeichen garantiert Neutralität. Für Kaminöfen gibt es dieses Siegel aber noch nicht.
Innovativ sein
Mehr Vertrauen erwecken möchten auch die Hersteller. „Die KWB Easyfire CC4-Pelletheizung mit cleanEfficiency Technologie nutzt Energie aus dem Abgas, welches sonst durch den Kamin entweicht, und steigert somit den Wirkungsgrad der Anlage“, sagt Matschnig. Damit würde heizen mit Pellets noch effizienter und noch sauberer. Dafür wird an der Rückseite des Kessels ein Zusatzwärmetauscher eingesetzt um die Abgase anschließend zu kondensieren. „Die dadurch gewonnene Energie wird wieder dem Heizsystem zugeführt“, sagt Matschnig. Der Wärmetauscher besteht aus einem Glattrohr-Register aus Edelstahl, wodurch Staubpartikel nicht am Wärmetauscher anhaften was dazu beitragen soll dass Emissionen geringer ausfallen. Öfen sind damit ein weiteres Beispiel, dass sowohl Herstellern als Benutzern lediglich durch innovatives Handeln geholfen wird.
Redaktion: Wolfram Hülscher