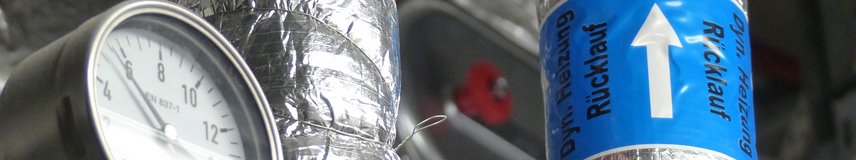Netzdienlichkeit bedeutet, Strom dann zu verbrauchen, wenn er im Überfluss vorhanden ist und den Verbrauch zurückzustellen, wenn Strom knapp ist. So können die fluktuierenden erneuerbaren Energien besser ins Netz integriert werden. GHD-Unternehmen weisen im Vergleich zu privaten Haushalten ein hohes technisches Potential für Netzdienlichkeit auf. Sie übernehmen aber im Gegensatz zur stromintensiven Industrie bisher noch keine aktive Rolle im Energiesystem, schreiben die Wissenschaftler des Forschungsprojekts FlexControl.
Einstellungen und Haltungen zu gesellschaftlich-politischen Themen sind nach Erkenntnissen des ISE entscheidend für die Bereitschaft, sich für die Netzdienlichkeit der eigenen Gebäude zu engagieren. Auf die Frage "Können betriebswirtschaftliche Gewinnerwartungen heruntergeschraubt werden, wenn gesellschaftliche Gewinne überzeugen?" antwortete die überwiegende Mehrheit der Befragten mit "Ja". Technische Ressourcen von Unternehmen hingegen beeinflussen die Kooperationsbereitschaft kaum.
Befragt wurden 93 Personen aus dem Projekt-, Gebäude- und Energiemanagement sowie Vertreter des mittleren und oberen Managements. Fast die Hälfte der Befragten ist in der Dienstleistungsbranche mit Bürogebäuden befasst, aber auch Handel, Gastronomie, Bildung und Gesundheitswesen waren vertreten. 21 Prozent der Teilnehmer kommen aus der Industrie. Mit der Umfrage sollte ausgelotet werden, auf Basis welcher Motivation die Betreiber für einen netzdienlichen Anlagenbetrieb zu gewinnen sind.
Das ISE erforscht und entwickelt selbst netzdienliche Betriebsführungsstrategien: Im Kleinen zielen sie darauf ab, die Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden energieeffizient zu gestalten. Im Großen können sie künftig dazu beitragen, erneuerbare Energien erfolgreich in Strom- und Wärmenetze zu integrieren. Wichtiger Teil des Projektes ist es, die Handlungsmöglichkeiten von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen und ihre Einstellungen diesen Strategien gegenüber zu erfassen.
Netzdienlichkeit ist im GHD-Sektor noch kein echtes Thema. Ein Viertel der befragten Unternehmen hat aber schon konkrete Pläne zu einer Implementierung. Und fast die Hälfte nimmt an, dass Netzdienlichkeit in den nächsten Jahren auf die Agenda der Unternehmensentscheidungen kommt. Unternehmen, deren Strategie von Innovations- und Risikobereitschaft geprägt ist und deren Unternehmensführung auch durch volkswirtschaftliche oder gesellschaftliche Aspekte beeinflusst wird, sind offenbar eher bereit, den Betrieb Ihrer Gebäude netzdienlich zu gestalten.
Die Macher der Studie "Netzdienlichkeit im GHD-Sektor" wollen das Thema Netzdienlichkeit von Gebäuden stärker in das allgemeine Bewusstsein gerückt wissen und als Chance für die Ziele Energiewende und Klimaschutz öffentlich herausstellen. Ein Instrument hierfür komme ein bundesweites Logo oder Zertifikat infrage, das zu etablieren sei und netzdienlich operierende Unternehmen auszeichne. Das Thema Netzdienlichkeit könne und sollte aber auch in der Nachhaltigkeitszertifizierung integriert werden.
Ein Risiko, das in der Befragung immer wieder geäußert wurde, war die Befürchtung eines Kontrollverlusts über die eigenen Anlagen und dadurch mögliche Betriebsausfälle oder Komforteinbußen. Dass diese Sorgen oft unbegründet sind, sollte mit einer geeigneten Informationsoffensive gezeigt werden, teilt die Forschungsinitiative Energiewendebauen mit.
Außerdem sei eine regulative Umgestaltung des Strommarktes notwendig, um den Markt für Flexibilitätsprodukte auf den verschiedenen Netzebenen zu stärken und neue Handlungsoptionen für Energiedienstleister zu eröffnen. Diese könnten es den Unternehmen ermöglichen, finanzielle Anreize und Spielräume etwa über variable Stromtarife anzubieten. Quelle: Forschungsinitiative Energiewendebauen / sue